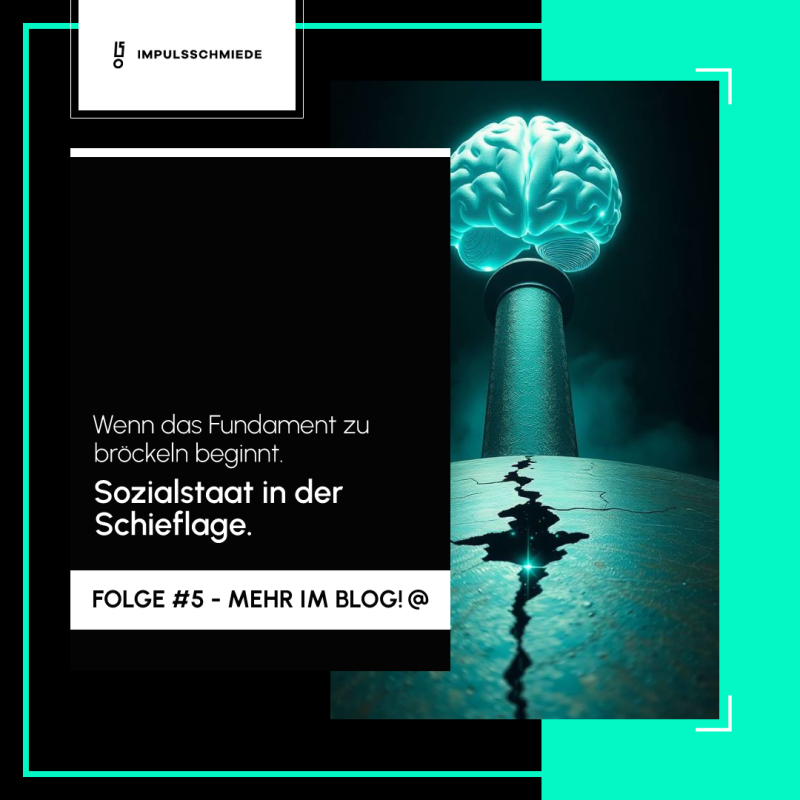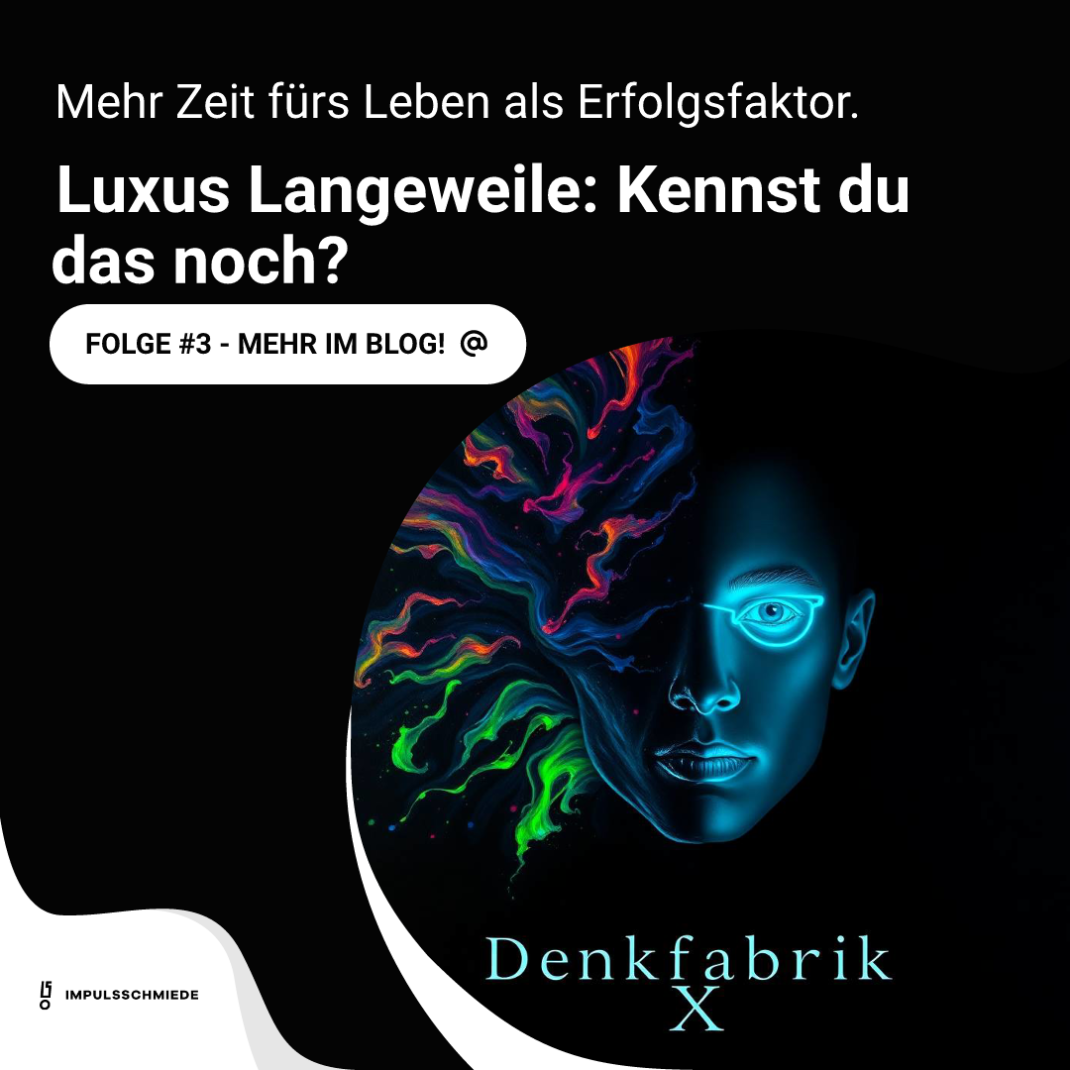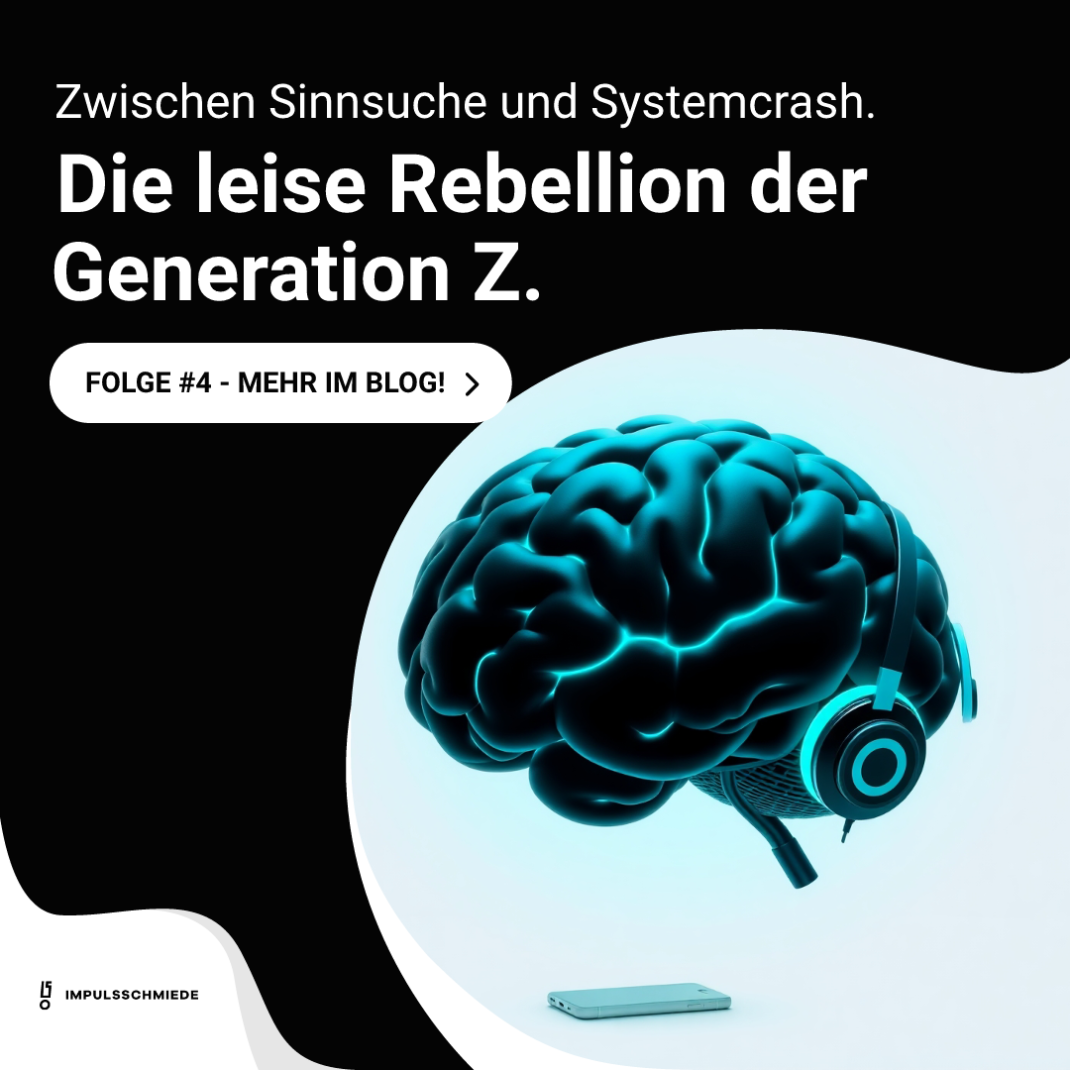Der Sozialstaat wankt – nicht nur finanziell.
Die zunehmende Staatsquote ist keine theoretische Größe mehr: Sie stieg von 11 % im Jahr 1880 auf über 50 % heute. Konkret heißt das, dass jeder zweite Euro, den wir verdienen, in die öffentlichen Kassen fließt. Zugleich steigen auch in Österreich die Sozialausgaben spürbar an – allein für die Sozialhilfe wurden zuletzt rund 1,1 Mrd. Euro pro Jahr aufgewendet.
Hinzu kommen hohe Kosten für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen. Und das in einer Zeit, in der Österreich das dritte Jahr in Folge in der Rezession steckt. Umso drängender wird die Frage: Wer trägt diese Last künftig – und warum gelingt es trotz milliardenschwerer Förderungen nicht, rund 300.000 erwerbsfähige Menschen in Beschäftigung zu bringen?
Die Debatte verdeutlicht: Der Unmut nimmt zu. Vor allem bei jenen, die Tag für Tag ihr Bestes geben und sich fragen, ob das System sie im Regen stehen lässt. Das Vertrauen in Politik und System ist am Tiefpunkt. Viele Bürger fühlen sich nicht mehr vertreten, sondern verwaltet. Während der Ruf nach Reformen laut ist, entscheidet eine kleine Minderheit über die Meinung der Mehrheit. Die gesellschaftliche Balance wankt – und mit ihr die Bereitschaft, das System mitzutragen. Wer heute noch solidarisch ist, tut das nicht aus Selbstverständlichkeit – sondern trotz wachsender Zweifel.